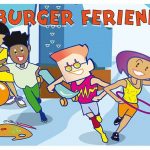Im Jahr 2014 hat der Senat den Beschluss gefasst, die koloniale Vergangenheit der Hansestadt zu erforschen. Es entstanden zahlreiche Initiativen, darunter der Runden Tisch „Koloniales Erbe“ und der Beirat zur Dekolonisierung Hamburgs.
Der Beirat hat auch ein Eckpunktepapier entwickelt, das als Grundlage für das nun vom Senat verabschiedete Erinnerungskonzept dient. Die Senatsstrategie vereint sämtliche Aktivitäten und Aktivitäten des Senats, der Fachbehörden, verschiedener Institutionen und der Akteure der Zivilgesellschaft. Sie beschreibt Handlungsbereiche, in denen eine dekolonisierende Erinnerungskultur in den kommenden Jahren behördenübergreifend und in enger Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft entwickelt werden sollte.
Die Stadt beschließt das stadtweite Erinnerungskonzept.
Das Konzept der Erinnerung betrachtet es als eine gesellschaftliche Querschnittsaufgabe, das koloniale Erbe zu bearbeiten. Er zielt darauf ab, eine Struktur zu etablieren, in der Verwaltung, Institutionen und Zivilgesellschaft sich aktiv mit dem weltweiten kolonialen Erbe Hamburgs auseinandersetzen. Die Einbeziehung der Betroffenen des Kolonialismus und seiner Folgen ist dabei von entscheidender Bedeutung. Daher soll das Konzept nicht als statisch betrachtet werden, sondern in den nächsten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt werden.
„Dekolonisierung hat das Ziel, eine freie, offene und gerechte Gesellschaft ohne Diskriminierung und Rassismus zu erreichen“, sagt Dr. Carsten Brosda, Senator für Kultur und Medien. Seit dem Beschluss des Senats im Jahr 2014 wurden viele Initiativen gestartet, die es uns ermöglichen, unsere koloniale Vergangenheit zu konfrontieren. Die Entstehung erfolgte durch einen partizipativen und transparenten Prozess. Es geht auch darum, in der Aufarbeitungsgeschichte eigene Schwachstellen zu identifizieren. Wenn wir auf diejenigen hören, die Nachkommen ehemals kolonisierter Menschen sind und die die Auswirkungen kolonialer Herrschaft bis heute auf eine besondere Art und Weise empfinden, kann dies nur geschehen lassen. Mit dem Erinnerungskonzept haben wir die Grundlage geschaffen, um diesen Weg weiterzugehen.“
„Langjähriger Druck und die Arbeit von zivilgesellschaftlichen und diasporischen Gruppen wie freedom roads!“, lautete der Beirat zur Dekolonisierung Hamburgs. Der Black History Month oder die Initiative für Straßenumbenennungen haben die Möglichkeit zur Dekolonisierung in Hamburg eröffnet. Wie die Statuen von Kolumbus und Vasco da Gama am Eingang zur HafenCity wurden koloniale Spuren oft bis heute unkommentiert fortbestehen oder wurden in ein Stadtbild integriert, das Hamburg als Schauplatz europäischer Entdeckungen und Globalisierung feiert. Der Baakenhafen, der Tierpark Hagenbeck, die Gefallenengedenktafel in der Hauptkirche St. Michaelis, das Kontorhaus „Afrika-Haus“, die ehemalige Lettow-Vorbeck-Kaserne sowie Einrichtungen wie die Handelskammer Hamburg sind nur einige der weitgehend unkommentierten Leerstellen. Um eine dekolonisierende Erinnerungskultur zu fördern, ist es notwendig, die bedeutende Bedeutung von Hamburg für den deutschen und den europäischen Kolonialismus zu erkennen und zu würdigen.
Das maritime Erbe der Hansestadt Hamburg ist ebenfalls ein Erbe der Koloniezeit. „Es liegt in der Verantwortung einer Stadtgesellschaft, die Weltoffenheit für sich erklärt, ihre koloniale Vergangenheit und deren Konsequenzen zu konfrontieren.“
Im Konzept werden die folgenden Handlungsbereiche beschrieben:
1. Vertiefung der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Kolonialismus
Die Forschungsstelle „Hamburgs (post-)koloniales Erbe“ wurde bereits 2015 an der Universität Hamburg gegründet. Seitdem ist sie für eine kolonialkritische Erinnerungskultur von großer Bedeutung. Diese soll weitergehen. Das Präsidium der Universität Hamburg und die Fakultät für Geisteswissenschaften haben sich eindeutig verpflichtet, die postkoloniale Forschung in der Fakultät zu etablieren. Ein weiteres Ziel besteht darin, die Zusammenarbeit internationaler Wissenschaftler mit Institutionen in ehemals deutschen Kolonien zu verstärken. Es geht jedoch auch darum, koloniale Herkunft wissenschaftlich zu erforschen und die Wiederherstellung von kulturellen Gütern und menschlichen Gebeinen zu begleiten. Hier spielt das MARKK bereits auf internationaler Ebene eine entscheidende Rolle, etwa bei der Rückgabe der Benin-Bronzen.
2. Die Vermittlung von Wissen über Kolonialismus und seine Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt.
Es ist geplant, Rahmenpläne, Lehrmaterialien und Bildungsempfehlungen zu entwickeln, um das Thema in Kindertagesstätten, Schulen und Berufsschulen fest zu etablieren. Damit sollen Pädagogen und Lehrern bei der Vermittlung von Wissen über Kolonialismus geholfen werden. Die Bildungspläne für die allgemeinbildenden Schulen wurden von 2020 bis 2023 von der Behörde für Schule und Berufsbildung bereits ausführlich überarbeitet, wobei auch das Thema Kolonialismus in besonderem Maße berücksichtigt wurde. Dieser Vorgang wird fortgesetzt, indem konkrete Projekte entwickelt und bewertet werden. Außerdem können Bildungsangebote und außerschulische Lernorte zu den Themen Kolonialismus, Rassismus und Migration einen bedeutenden Beitrag leisten. Die Museen werden diese Themen beispielsweise noch stärker in ihre Ausstellungen und Angebote aufnehmen.
3. Schaffung von würdigen Formen und Orten für das dekolonisierende Erinnern
In der Stadt gibt es viele Stätten, die die koloniale Vergangenheit der Hansestadt erinnern. In den letzten Jahren haben sich in Hamburg verschiedene Orte und Formen des postkolonialen Erinnerns entwickelt oder entwickeln sich derzeit. Hamburg dekolonisieren! wird von der Stiftung Historische Museen Hamburg (SHMH) durchgeführt. Initiative, um das koloniale Erbe der Stadt zu diskutieren. Die Bundeskulturstiftung und die Behörde für Kultur und Medien unterstützen das Projekt. Auch dies zielt darauf ab, moderne Ideen für Lern- und Erinnerungsorte zum deutschen Kolonialismus zu entwickeln. Das Bismarck Denkmal im Alten Elbpark und die Askari Reliefs in Jenfeld sollen auch weiterhin kritisch betrachtet werden. Das Staatsarchiv hat schon eine spezialisierte Strategie für den Umgang mit Straßennamen der Kolonialzeit vorgelegt. Auf dieser Basis werden die Distrikte nun Vorschläge zur Neubenennung oder zur kritischen Beurteilung von Straßennamen mit kolonialem Bezug unterbreiten. Darüber hinaus wird das Denkmalschutzamt der BKM in Zukunft eine stärkere Betrachtung der kolonialen Bedeutungsdimension bei der Erfassung und Bewertung von Denkmalen vornehmen. Dadurch wird es einen Beitrag zur Vertiefung der wissenschaftlichen Aufarbeitung des Kolonialismus leisten und Orte des dekolonisierenden Gedenkens schaffen.
4. Den Dialog über Kolonialgeschichte fördern und zur Versöhnung beitragen.
Besonders in der Städtepartnerschaft mit Daressalam ist die Kolonialgeschichte und ihre Folgen ein kontinuierliches Thema. Im Rahmen von Schul- und Jugendaustauschen ist dieses Thema weiterhin von besonderer Bedeutung. Die Perspektive der tansanischen Partnerinnen und Partnern sollte verstärkt werden. Im Rahmen von Städtepartnerschaften, in der Wissenschaft oder im internationalen Austausch sollte verstärkt auf die Aufarbeitung des Kolonialismus geachtet und der interkulturelle Dialog gefördert werden. In diesem Kontext sind auch private Unternehmen gefordert, ihre Geschichte aufzuarbeiten und Handelsbeziehungen zu überprüfen. Die Senatskanzlei fördert seit vielen Jahren die Aktivitäten der Fair Trade Stadt Hamburg, um die Öffentlichkeit für ungerechte Strukturen im Welthandel zu sensibilisieren und das Angebot fair gehandelter Produkte zu erhöhen.
5. Zivilgesellschaftliche Aktivitäten in der Dekolonisierungskultur stärken.
Eine lebendige, dekoloniale Erinnerungskultur erfordert eine aktive Zivilgesellschaft. Die Projektförderung und die institutionelle Förderung sollen kontinuierlich angemessene Ressourcen für dekolonisierende zivilgesellschaftliche Aktivitäten zur Verfügung stellen. Es soll verstärkt Orte, Strukturen und Formate gefördert werden, die sich mit dem kolonialen Erbe befassen und zur Aufarbeitung beitragen. Zur Stärkung der post- und dekolonialen Erinnerungskultur in Hamburg soll eine hauptamtliche Koordinierungsstelle für Dekolonisierung eingerichtet werden. Sie sollte idealerweise bei einer Stiftung oder einem bereits bestehenden zivilgesellschaftlichen Träger angesiedelt werden, um eine stärkere Professionalisierung und Kontinuität zivilgesellschaftlicher Strukturen zu gewährleisten und eine Unabhängigkeit zu gewährleisten.
Open-Air-Festival „DIGGAHH“.
Im Kontext des Projekts Hamburg dekolonisieren! Die Initiative zur Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe der Stadt, die von der Behörde für Kultur und Medien gefördert wird, lädt vom 22. bis 26. Mai 2024 zahlreiche Hamburger Initiativen aus Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftlicher Community zum Open Air „DIGGAHH“ (Dekolonial / Interaktiv / Gemeinsam / Aktuell / Hansestadt Hamburg) ein. Das vielfältige Programm, das von einem kuratorischen Team aus verschiedenen Vertretern der Zivilgesellschaft entwickelt worden ist, umfasst neben Workshops und Talks auch Lesungen und Führungen sowie Beiträge aus Kunst und Musik. Das Open Air, das am Musikpavillon in Planten un Blomen und an weiteren Orten der Stadt stattfinden wird, soll die Dekolonisierung vorantreiben und Raum für mehr Auseinandersetzung mit dem kolonialen Erbe schaffen.