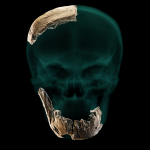Am 25. November begeht die Welt den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen – einen Tag, der uns daran erinnert, dass geschlechtsspezifische Gewalt keine abstrakte Statistik, sondern eine Realität im Leben von Millionen Frauen ist. Für die jüdische Gemeinschaft hat dieser Tag nicht nur globale, sondern auch zutiefst interne Bedeutung: Er fordert uns auf, Verantwortung füreinander zu übernehmen und den Wert des menschlichen Lebens, der in der Tora verankert ist, aktiv zu schützen.
Eine Realität, die auch uns betrifft
Gewalt gegen Frauen macht vor Herkunft, Religion oder sozialem Status keinen Halt. Auch innerhalb jüdischer Communities – ob säkular, traditionell oder orthodox – gibt es Frauen, die psychische, physische, sexuelle oder ökonomische Gewalt erleben. Rabbinerinnen, Sozialarbeiterinnen und jüdische Organisationen berichten seit Jahren: Gewalt kann überall vorkommen, auch dort, wo wir sie am wenigsten erwarten.
Gerade für Betroffene, die aus religiösen oder eng vernetzten Gemeinschaften stammen, ist der Weg zur Hilfe jedoch besonders schwer. Angst vor sozialer Ausgrenzung, Abhängigkeit vom Partner, Schamgefühle oder das Missverständnis, häusliche Konflikte seien „familiäre Privatsache“, verhindern oft eine rechtzeitige Intervention.
Jüdische Werte verpflichten uns zum Handeln
Unsere Tradition ist eindeutig:
„Lo ta’amod al dam re’echa“ – Steh nicht untätig daneben, wenn das Blut deines Nächsten vergossen wird.
(Vajikra/Lev 19,16)
Dieser Vers erinnert uns daran, dass Wegsehen keine Option ist – nicht in der Öffentlichkeit, nicht im familiären Umfeld und nicht in der eigenen Gemeinde. Schutz des Lebens und der körperlichen wie seelischen Unversehrtheit sind Grundpfeiler jüdischer Ethik.
Auch halachische Autoritäten verschiedener Strömungen betonen:
-
Körperliche und psychische Misshandlung widersprechen eindeutig jüdischem Recht.
-
Rabbiner und Gemeindevorstände tragen eine besondere Verantwortung, Betroffenen sichere Wege zu Beratung und Unterstützung zu eröffnen.
-
Schalom bajit – häuslicher Friede – bedeutet niemals, Gewalt zu ertragen.
Israel und die jüdische Diaspora: Eine gemeinsame Herausforderung
In Israel wie in der Diaspora haben Institutionen und Frauenorganisationen in den letzten Jahren verstärkt Programme zur Prävention und Unterstützung aufgebaut. Besonders bemerkenswert ist die Arbeit von Initiativen, die religiöse Sensibilitäten respektieren und gleichzeitig klar gegen Gewalt Stellung beziehen.
Doch trotz aller Fortschritte bleibt viel zu tun:
-
Die Zahl gemeldeter Fälle ist nur die Spitze des Eisbergs.
-
Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und wirtschaftliche Abhängigkeiten erschweren es vielen Migrantinnen, Hilfe zu suchen.
-
Antisemitische Gewalt gegen jüdische Frauen – ob auf der Straße oder online – hat seit 2023 weltweit zugenommen und stellt eine zusätzliche Dimension des Risikos dar.
Was wir heute tun können
Der internationale Gedenktag ist ein Moment des Innehaltens – aber auch ein Aufruf zum Handeln. Jede und jeder von uns kann etwas beitragen:
1. Zuhören und hinsehen:
Trauen wir Frauen, die uns von Gewalt berichten, uneingeschränkt Glauben und unterstützen wir sie ohne Vorurteile.
2. Gemeindestrukturen stärken:
Synagogen, jüdische Schulen und Vereine können sichere Ansprechstellen schaffen und Fachleute schulen.
3. Sprache verändern:
Gewalt beginnt oft nicht mit Schlägen, sondern mit Worten. Sensibilisierung für Demütigung, Kontrolle und Manipulation ist zentral.
4. Betroffene nicht allein lassen:
Ein Anruf, eine Begleitung zu einer Beratungsstelle oder einfach eine verlässliche Bezugsperson zu sein, kann Leben retten.
Ein Tag des Gedenkens – und ein Aufruf zur Hoffnung
Gewalt gegen Frauen ist ein tiefes menschliches und gesellschaftliches Problem. Doch es ist kein unveränderliches Schicksal. Jede Stimme, die sich erhebt, jede Frau, die Unterstützung erhält, jede Gemeinschaft, die Verantwortung übernimmt, bringt uns einer Welt näher, in der Gewalt nicht verschwiegen, sondern überwunden wird.
Der 25. November erinnert uns:
Der Kampf gegen Gewalt ist ein jüdisches Gebot – und eine kollektive Aufgabe.