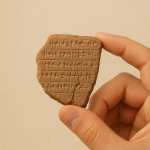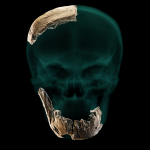Der Beauftragte der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, Felix Klein, fordert ein Gesetz, das bestimmte pro-palästinensische Parolen wie „From the river to the sea“ verbietet. Seine Initiative löst erneut eine hitzige Diskussion über Deutschlands besondere Verantwortung gegenüber Israel und die Grenzen der Meinungsfreiheit aus.
Klein möchte Äußerungen untersagen lassen, die als Aufruf zur Zerstörung Israels interpretiert werden können. Unterstützung erhält er dabei unter anderem vom Bundesinnenminister Alexander Dobrindt. Der Vorschlag werde im Justizministerium geprüft, sagte Klein gegenüber der israelischen Zeitung Haaretz.
„Vor dem 7. Oktober konnte man noch argumentieren, dass der Slogan nicht zwangsläufig bedeutet, Israelis vertreiben zu wollen – das konnte ich akzeptieren“, so Klein. „Aber seitdem ist Israel mit realen existenziellen Bedrohungen konfrontiert. Deshalb halte ich es für notwendig, die Meinungsfreiheit in diesem Punkt einzuschränken.“
Klein betonte zudem, dass ein entsprechendes Gesetz selbst dann wichtig sei, wenn es gerichtlichen Anfechtungen wegen möglicher Grundrechtsverstöße ausgesetzt würde.
Nach dem 7. Oktober: Erschütterung deutscher Grundüberzeugungen
Die Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und der darauf folgende Gaza-Krieg haben zentrale Grundannahmen deutscher Politik erschüttert. Seit Kriegsbeginn verzeichnet Deutschland einen deutlichen Anstieg antisemitischer, aber auch islamfeindlicher Vorfälle.
Gleichzeitig wurden Debatten darüber geführt, wann Deutschland seine historische Verantwortung gegenüber dem jüdischen Staat priorisiert – und wann demokratische Prinzipien wie Demonstrations- und Meinungsfreiheit im Vordergrund stehen.
Die rechtliche Einordnung pro-palästinensischer Parolen ist schon jetzt komplex: Gerichte müssen fallweise entscheiden, ob ein Slogan wie „From the river to the sea, Palestine will be free“ als politischer Protest oder als Billigung von Terror interpretiert wird. So wurde die deutsch-iranische Aktivistin Ava Moayeri im August 2024 wegen „Billigung einer Straftat“ verurteilt, nachdem sie den Slogan auf einer Berliner Demo skandiert hatte.
Breite Protestverbote – und Jüdinnen und Juden im Fokus der Maßnahmen
Unmittelbar nach den Hamas-Angriffen verhängten zahlreiche Kommunen pauschale Verbote pro-palästinensischer Demonstrationen. In Berlin durften Schulen sogar das Tragen der Kufiya untersagen.
Von diesen Maßnahmen waren paradoxerweise auch jüdische und israelische Aktivist*innen betroffen. Im Oktober 2023 wurde eine jüdisch-israelische Frau festgenommen, weil sie ein Plakat mit der Aufschrift „Als Jüdin und Israelin: Stoppt den Genozid in Gaza“ hielt. Eine Demonstration der Gruppe „Jewish Berliners against Violence in the Middle East“ wurde ebenfalls untersagt – angeblich aus Sorge vor „aufwieglerischen, antisemitischen Äußerungen“.
Ausweisungen und Staatsräson: Politisches Prinzip ohne juristische Grundlage
Zu Beginn des Jahres ordneten deutsche Behörden die Abschiebung von vier ausländischen Staatsangehörigen an, die an pro-palästinensischen Aktionen teilgenommen hatten. In drei Fällen wurde dabei explizit auf Deutschlands „Staatsräson“ verwiesen – also das politische Grundprinzip, die Sicherheit Israels als Teil deutscher Staatsidentität zu betrachten.
Der Jurist Alexander Gorski, der einige der Betroffenen vertritt, hält die Bezugnahme jedoch für juristisch irrelevant:
„Staatsräson ist kein Rechtsbegriff. Sie steht nicht im Grundgesetz, nicht in der Verfassung“, sagte er im April der Jewish Telegraphic Agency.
Zunahme offener Diskriminierung gegen Juden und Israelis
Parallel dazu kam es zu Fällen offener Ausgrenzung: Ein Geschäft in Flensburg mit dem Schild „Juden verboten“ fällt klar unter das deutsche Antidiskriminierungsrecht. Anders verhält es sich mit einem Restaurant in Fürth, das Israelis explizit den Zutritt verweigerte – laut Antidiskriminierungsbeauftragter Ferda Ataman greife das Gesetz bei Nationalität nicht.
Klein kündigte an, auch hier gesetzliche Anpassungen anzustoßen, um Israelis und andere Nationalitäten künftig besser zu schützen.
Klein: Anti-Zionismus meist eine Form von Antisemitismus
Felix Klein arbeitet seit Jahren eng mit jüdischen Organisationen zusammen und war maßgeblich an der Entwicklung der IHRA-Arbeitsdefinition für Antisemitismus beteiligt – eine Definition, die auch Kritik hervorgerufen hat, weil sie anti-israelische Positionen teils als antisemitisch einordnet.
Klein sieht darin jedoch wenig Widerspruch:
„In den meisten Fällen ist Anti-Zionismus nur eine verkleidete Form von Antisemitismus“, sagte er. „Wenn Menschen sagen, sie seien gegen Israel, meinen sie häufig die Juden.“