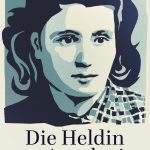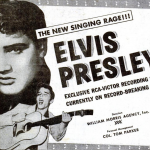Wenn heute von Ostpreußen die Rede ist, dann ist das zumeist eine Erinnerung – an eine untergegangene Provinz, an deutsche Geschichte jenseits der Oder, an Orte, die verschwunden sind oder nun andere Namen tragen. Doch Ostpreußen war auch eine Region jüdischen Lebens – über Jahrhunderte, und mit allen Spannungen, Brüchen und Zerstörungen, die diese Geschichte prägten.
Der Historiker und Filmemacher Hermann Pölking, bekannt durch sein Buch „Ostpreußen – Biographie einer Provinz“, hat nun mit „Ostpreußen – Entschwundene Welt“ einen Film geschaffen, der die Region in ihren letzten Jahrzehnten vor dem Untergang dokumentiert – ausschließlich anhand historischer Filmaufnahmen. Ohne Interviews, ohne nachgestellte Szenen, ohne nachträgliche Kommentierung entsteht eine visuelle Erzählung, die sich auch und gerade einem jüdischen Publikum mit großem Respekt nähert.
Die jüdische Perspektive: Sichtbar im Unsichtbaren
Jüdisches Leben in Ostpreußen war niemals dominant, aber stets ein fester Bestandteil der städtischen Kultur – vor allem in Königsberg, Tilsit, Insterburg und anderen größeren Orten. Doch in den erhaltenen Amateurfilmen, auf denen dieser Kompilationsfilm beruht, ist dieses Leben selten explizit zu erkennen. Pölking geht mit dieser Leerstelle bewusst um. Die jüdische Geschichte wird nicht übergangen – sie ist präsent im Kontext, im Erzählen, im Verstehen dessen, was fehlt.
Besonders eindrücklich: Der Film verweist auf die unmittelbare Brutalität der nationalsozialistischen Politik in der Region – insbesondere nach dem Überfall auf Polen 1939, als das angrenzende Masowien von den ostpreußischen Nationalsozialisten als „Neuostpreußen“ beansprucht wurde. Dort begannen sofort die systematischen Verfolgungen der jüdischen Bevölkerung – Enteignung, Deportation, Mord. Pölking nennt diese Verbrechen beim Namen. Dabei bleibt er sachlich – aber nie neutral.
Kein nostalgischer Blick – sondern ein reflektierter
Gerade im Umgang mit ostdeutscher Geschichte ist die Gefahr einer nostalgischen Verklärung groß. Pölking vermeidet dies konsequent. Er arbeitet heraus, wie tief Ostpreußen bereits vor dem Krieg im autoritären Denken verankert war. Der Aufstieg des Nationalsozialismus wird im Film sichtbar – etwa durch die frühen Wahlerfolge Hitlers in der Region oder durch die propagandistischen „Deutschland-Flüge“ mit Stationen in ostpreußischen Städten.
Der Film dekonstruiert bewusst die Ästhetik der NS-Zeit, etwa bei den wenigen Ausschnitten aus sogenannten „Kulturfilmen“, die unter Goebbels Aufsicht entstanden. Statt diese Bilder unkommentiert wirken zu lassen, stellt Pölking ihnen ihre eigene Absicht entgegen – und entlarvt sie so.
Eine Region in Farbe – aber nicht in Unschuld
Etwa 40 Prozent des Materials stammt aus Farbbildaufnahmen zwischen 1937 und 1944. Diese Filme – oft von Amateurfilmern aufgenommen – zeigen eine vermeintlich heile Welt: Bauern bei der Arbeit, Kinder beim Baden, Winterlandschaften. Doch diese Bilder stehen im Kontrast zu dem Wissen, das man heute über die Zeit hat. Das macht ihre Wirkung ambivalent: Die Schönheit der Aufnahmen ist real, aber sie ist nie unschuldig.
Zugleich ist der Film ein Plädoyer für eine kritische Erinnerungskultur. Denn gerade die scheinbar privaten Aufnahmen offenbaren oft mehr über Mentalität, Zeitgeist und gesellschaftliche Blindheit als offizielle Dokumente.
Erinnern durch Erzählen
Pölkings Film ist kein klassischer Geschichtsfilm, sondern ein erzählendes Zeitbild. Aus über 100 Filmquellen – gesammelt über zwölf Jahre – hat er ein dichtes Mosaik erschaffen. Er macht dabei auch deutlich, wie viel Mühe es gekostet hat, die Filme historisch einzuordnen, Orte und Zeiten zu identifizieren. Hinter jedem Bild steht ein Kontext, hinter jedem Straßenzug eine Geschichte – auch eine jüdische.
Die jüdischen Gemeinden Ostpreußens wurden im Holocaust fast vollständig ausgelöscht. Ihre Synagogen brannten, ihre Menschen wurden deportiert und ermordet. Der Film erinnert daran – nicht plakativ, sondern durch das, was er zeigt und was er nicht mehr zeigen kann. In dieser Leerstelle liegt seine Kraft.Fazit
„Ostpreußen – Entschwundene Welt“ ist ein Film, der zum Nachdenken einlädt. Er richtet sich an alle, die sich für deutsche und europäische Geschichte interessieren – auch und besonders aus jüdischer Perspektive. Er erzählt von einem Land, das vergangen ist, von einer Welt, die zerstört wurde – und davon, wie wichtig es ist, diese Erinnerung wach zu halten.
Für jüdische Zuschauerinnen und Zuschauer ist der Film kein sentimentaler Rückblick, sondern ein historisch differenziertes Dokument – das zeigt, wie sichtbar Geschichte werden kann, wenn man ihr die Bilder zurückgibt, die sie verdient. Und wie schmerzhaft es ist, wenn genau diese Bilder fehlen.
Copyright Foto: Die Wolfsschanze im Mauerwald bei Rastenburg am Morgen des 11. Februar 1942. Aus einem 35mm Agfacolor Kinefilm von Walter Frentz