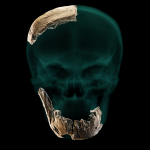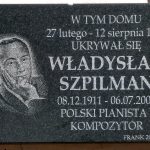Das große europäische Kosmetikunternehmen Weleda hat sich verpflichtet, seine Geschichte aus der Nazizeit zu überprüfen, nachdem bekannt wurde, dass es während des Holocaust von grausamen Menschenversuchen in einem Konzentrationslager profitiert hatte.
Weleda, 1921 in Deutschland von einer Schweizer Muttergesellschaft gegründet, behauptete, dass seine Hautcreme deutsche Soldaten vor Erfrierungen schützen könne. Um diese Behauptung zu beweisen, führten Nazi-Ärzte und ihre Assistenten – von denen einige Verbindungen zu Weleda hatten – brutale Experimente mit der Creme an etwa 300 Häftlingen im Konzentrationslager Dachau durch, bei denen diese stundenlang in Wasser mit Eisblöcken getaucht wurden.
Etwa 80 bis 90 Häftlinge starben dabei – eines von unzähligen Beispielen für unmenschliche medizinische Experimente, denen die Nazis ihre Opfer unterzogen.
Die deutsche Historikerin Anne Sudrow deckte die Weleda-Experimente in einem neuen Buch auf, das am Montag unter der Schirmherrschaft der Gedenkstätte Dachau veröffentlicht wurde. Sie wurden letzte Woche erstmals in der Zeitschrift Der Spiegel öffentlich gemacht.
Als Reaktion auf die Enthüllungen erklärte das Unternehmen, das heute seinen Sitz in Arlesheim in der Schweiz hat, dass es seine Geschichte aus der Nazizeit neu untersuchen werde. Eine interne Studie, die im vergangenen Jahr veröffentlicht wurde, konnte die Rolle von Weleda bei den Menschenversuchen nicht aufdecken.
„All diese neuen Forschungsergebnisse geben uns Anlass, unsere Geschichte mit einer groß angelegten, unabhängigen Studie eingehend zu überdenken“, erklärte Weleda-CEO Tina Müller in einer Stellungnahme. Die neue Studie wird voraussichtlich zwei Jahre in Anspruch nehmen.
Sudrow fand heraus, dass das Unternehmen enge Verbindungen zur SS hatte und von der Sklavenarbeit in Dachau profitierte, indem es dort von Häftlingen angebaute Heilkräuter zu reduzierten Preisen bezog. Das Unternehmen belieferte das Lager mit einer Creme, die eine frostschützende Wirkung haben sollte. Der SS-Arzt Sigmund Rascher führte Menschenversuche durch, um die – angeblich von Weleda vertretene – Hypothese zu überprüfen, dass das Produkt Soldaten vor Erfrierungen schützen und Amputationen überflüssig machen könnte. Zwei ehemalige Weleda-Mitarbeiter leiteten die Versuche und berichteten der Unternehmensleitung, berichtete Sudrow.
Als Berichte über diese Enthüllungen auftauchten, verurteilte das Unternehmen in einer Erklärung den Nationalsozialismus. „Wir bei Weleda verurteilen die Gräueltaten des Nationalsozialismus auf das Schärfste“, hieß es darin. „Faschismus, Antisemitismus, Rassismus oder rechtsextreme Ideologien haben in unserem Unternehmen keinen Platz. Weleda ist ein Ort der Menschlichkeit. ‚Nie wieder‘ bringt unsere Haltung zum Ausdruck.“
Weleda ist ein Naturkosmetikunternehmen, das von Rudolf Steiners anthroposophischer Bewegung inspiriert wurde, einer quasi-religiösen Bewegung, die von den Nazis offiziell verboten wurde und einige ähnliche Ideen vertrat. Es wurde 1921 in Schwäbisch Gmünd in Baden-Württemberg gegründet, wo es homöopathische Arzneimittel, Nahrungsergänzungsmittel und Hautpflegeprodukte herstellte.
Heute ist es ein zunehmend profitables Kosmetikunternehmen, das in 50 Ländern tätig ist und im letzten Jahr einen Umsatz von mehr als 450 Millionen Euro erzielte. Während es in Europa am beliebtesten ist, hat insbesondere seine Windelcreme in den Vereinigten Staaten Kultstatus.
Eine Seite auf seiner Website, die die Aktivitäten des Unternehmens von 1933 bis 1945, als das Nazi-Regime Deutschland regierte, dokumentierte, wurde diese Woche entfernt. Laut einer Version der Seite vom August, die über das Internetarchiv verfügbar ist, hieß es dort jedoch, dass Weleda von den Nazis verfolgt worden sei und dass zwar ehemalige Weleda-Mitarbeiter Nazis gewesen seien, das Unternehmen jedoch nicht an der Verwendung seiner Produkte durch die Nazis beteiligt gewesen sei. Laut einem Historiker, der das Unternehmen untersucht hatte, hieß es auf der Seite: „Weleda hat sich nicht an der unmenschlichen Politik der Nazi-Diktatur beteiligt.“
Auf der Seite hieß es auch, dass Weleda einen Beitrag zur EVZ-Stiftung geleistet habe, einem Fonds zur Unterstützung von Bildungs- und Gedenkinitiativen im Zusammenhang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit Deutschlands, der im Jahr 2000 von der Regierung ins Leben gerufen wurde. Die Unternehmensleitung erklärte damals laut der Seite: „Die Weleda AG hat in ihrer Geschichte niemals Zwangsarbeiter beschäftigt. Sie erkennt jedoch die Mitverantwortung der Deutschen für das Unrecht an, das Zwangsarbeitern unter der nationalsozialistischen Herrschaft im Zweiten Weltkrieg widerfahren ist.“
Mehrere große deutsche Unternehmen, von Banken bis hin zu Automobilherstellern, haben Studien über ihre Aktivitäten während des Krieges in Auftrag gegeben, die Ergebnisse veröffentlicht und sich an Fonds beteiligt, die ehemalige Zwangsarbeiter und Bildungsprojekte unterstützen. So gründete beispielsweise die Familie Reimann, Erben eines deutschen Unternehmens, das von Zwangsarbeitern aus der Nazizeit profitiert hatte, im Jahr 2019 die Alfred-Landecker-Stiftung, um Antisemitismus zu bekämpfen, Holocaust-Studien zu unterstützen und demokratische Werte zu fördern.