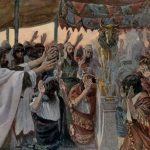Jemanden von der Teilnahme am Gemeinschaftsleben durch soziale Ächtung oder in einigen Fällen durch Exkommunikation auszuschließen – was wir heute oft als Canceln bezeichnen – hat eine lange Geschichte im jüdischen Leben. Von biblischen Zeiten bis in die heutige Zeit wurden diese Mittel der sozialen Missbilligung eingesetzt, um bestimmte Ideen oder Personen außerhalb der gemeinschaftlichen Normen zu erklären, obwohl sie im Allgemeinen nur selten und in der Regel mit der Zustimmung anerkannter kommunaler Autoritäten angewendet wurden. Technisch gesehen kann diese Strafe für eine Reihe von Vergehen verhängt werden, darunter auch so harmlose wie Respektlosigkeit, doch wurde sie hauptsächlich zur Bestrafung von Ketzern eingesetzt.
Was ist Cancel-Kultur?
Bei der Cancel-Kultur handelt es sich um die Vorstellung, dass bestimmte Handlungen oder Ideen so völlig jenseits der Norm sind, dass ihre Verfechter den Ausschluss aus der höflichen Gesellschaft verdienen. Die genauen Parameter der Absage können variieren. Die meisten würden zustimmen, dass die Bemühungen, einen Straftäter zu deplattieren, von einer bestimmten Social-Media-Website zu vertreiben, von einer ehrenvollen oder einflussreichen Position zu entfernen oder sogar von seinem Arbeitsplatz zu entlassen, als Annullierung gelten. Der Begriff wird aber auch für Versuche verwendet, einen finanziellen Preis für eine vermeintliche kulturelle Übertretung zu verlangen, z. B. wenn Werbekunden ihre Unterstützung für eine Talkshow zurückziehen, deren Moderator etwas Unangemessenes gesagt hat. Die Zielpersonen der Cancel-Kultur können sich rehabilitieren und tun dies manchmal auch, aber wie der Begriff selbst schon andeutet, impliziert das Canceln einen Versuch, die Täter und ihre Ansichten aus dem gesellschaftlichen Diskurs zu eliminieren.
Für die Befürworter dieser Praxis ist die Löschung ein legitimes Mittel, um die öffentliche Debatte in bestimmten Grenzen zu halten. Kritiker sehen darin jedoch eine Form des Totalitarismus, bei der für Abweichungen ein so hoher Preis verlangt wird, dass sich viele Menschen gezwungen sehen, sich an die Regeln zu halten. Obwohl sich das Phänomen als ausgesprochen modern anfühlt – der Begriff selbst ist erst in den 2010er Jahren in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangen und wird oft durch empörte Reaktionen im Internet angeheizt – ist die Praxis, bestimmte Ideen, Handlungen oder sogar Menschen als jenseits der Grenzen zu bezeichnen, in der jüdischen Tradition fest verankert.
Als Gott Amalek auslöschte
Das wohl engste Korrelat zur Cancel-Kultur in der Tora ist Gottes Befehl, den Stamm der Amalekiter zu vernichten. Das Gebot steht in Deuteronomium 25,19, wo die Israeliten angewiesen werden, „das Andenken an Amalek unter dem Himmel auszutilgen“. Das hebräische Wort für auslöschen – timcheh – hat eine gemeinsame Wurzel mit einem Ausdruck, der heute in einigen jüdischen Gemeinden im Zusammenhang mit den Nazis verwendet wird: y’mach sh’mam, was wörtlich bedeutet: „Mögen ihre Namen ausgelöscht werden“.
Die genaue Art der Sünde, die eine solch einzigartige Strafe für Amalek verdient hat – der Stamm ist nicht der einzige, der Krieg gegen die Israeliten geführt hat, aber er ist der einzige, der zur vollständigen Ausrottung bestimmt ist – ist Gegenstand von Debatten. Einige Autoritäten sind der Meinung, dass sich die Amalekiter gegen die Schwachen richteten und ein schwaches israelitisches Volk, das gerade aus der ägyptischen Sklaverei befreit worden war, von hinten angriffen. Andere meinen, dass sie die Israeliten kurz nach den Wundern des Exodus angriffen und damit einen schamlosen Mangel an Gottesfurcht demonstrierten. Während es also klar ist, dass die Tora in mindestens einem Fall eindeutig sagt, dass eine Annullierung verdient – und in der Tat obligatorisch – ist, ist nicht klar, welche genauen Umstände sie erfordern.
Der Abschnitt des Deuteronomiums mit den drei Geboten über Amalek – ihn auszurotten, sich an seine Taten zu erinnern und ihn nicht zu vergessen – wird öffentlich in einer zusätzlichen Tora-Lesung am Schabbat vor Purim vorgetragen, dem Feiertag, dessen Hauptbösewicht, Haman, ein Nachkomme Amaleks sein soll. (Wenn Hamans Name während der öffentlichen Lesung der Schriftrolle von Esther vorgelesen wird, ist es Tradition, Lärm zu machen, um ihn unhörbar zu machen – in der Tat, um ihn zu annullieren.) Spätere Rabbiner waren jedoch eindeutig unzufrieden mit dem, was wie eine Verpflichtung zum Völkermord aussieht. Der Talmud (Yoma 22b) enthält eine Lehre, die darauf hindeutet, dass König Saul – der Gottes Gebot aus dem Buch Samuel, die Amalekiter einschließlich ihrer Frauen, Kinder und Tiere auszurotten, nicht befolgte – mit Gott stritt und ihn fragte, warum er sich nicht der schuldlosen Kinder und Tiere erbarmen sollte.
Exkommunikation
Der andere biblische Begriff, der sich auf die Cancel-Kultur bezieht, ist Herem. In der Bibel wurde er mit „Exkommunikation“ übersetzt und bedeutete die Todesstrafe für eine Handvoll schwerer Sünden. In der talmudischen Zeit war Herem im Wesentlichen eine Form der schweren sozialen Ächtung. Der berühmteste Herem in der Geschichte war der des niederländischen Philosophen Benedikt Spinoza aus dem 17. Jahrhundert, der von der jüdischen Gemeinde in Amsterdam wegen nicht näher bezeichneter „abscheulicher Ketzereien, die er praktizierte und lehrte, und wegen seiner monströsen Taten“ exkommuniziert wurde.
Herem konnte für rein rhetorische Vergehen verhängt werden, wie es später mit Spinoza geschah. Maimonides zählte in seiner Aufzählung der 24 Vergehen, für die eine Exkommunikation gerechtfertigt war, eine Reihe von Verstößen auf, die man unter der allgemeinen Überschrift der Respektlosigkeit zusammenfassen könnte: Beleidigung eines Gelehrten, Bezeichnung eines Mitjuden als Sklave oder Beleidigung eines Boten des rabbinischen Hofes. Die meisten Punkte auf der Liste beziehen sich jedoch auf Ritualverstöße. Keiner davon ist das bloße Vertreten oder Äußern einer unpopulären Meinung.
Zu Maimonides‘ Zeiten wurde der Herem jedoch genau aus diesen Gründen verhängt. Gelehrte in Frankreich verboten seine Bücher wegen Ketzerei, da sie Maimonides‘ Versuch, jüdisches Denken und jüdische Philosophie zusammenzufassen, generell ablehnten und mehrere spezifische Behauptungen aufstellten, darunter die, dass Gott keine physische Form hat. Maimonides wiederum belegte einen anderen Führer der ägyptischen jüdischen Gemeinde, Sar Schalom ben Moses, wegen Steuervergehen mit dem Bann der Exkommunikation.
In der Neuzeit wurde der Herem nur selten und im Allgemeinen aus Gründen der ideologischen Abweichung verhängt. Im 18. Jahrhundert erließ der Wilna Gaon ein Exkommunikationsdekret gegen die aufkommende chassidische Bewegung, in dem er sie zu Häretikern erklärte, die eine Reihe von verwerflichen Praktiken ausübten. Im Jahr 1945 wurde Rabbiner Mordecai Kaplan, der Gründer der rekonstruktivistischen Bewegung, von einer Gruppe orthodoxer Rabbiner förmlich exkommuniziert, die auch ein von ihm verfasstes Gebetbuch öffentlich verbrannten und erklärten, dass er „totale Ketzerei und einen völligen Unglauben an den Gott Israels und an die Grundsätze des Gesetzes der Tora Israels demonstriert“. Im Jahr 2006 rief der Oberrabbiner Israels dazu auf, Mitglieder der chassidischen Sekte Neturei Karta zu exkommunizieren, von denen mehrere an einer Konferenz im Iran teilgenommen hatten, auf der angeblich bewiesen werden sollte, dass der Holocaust nicht stattgefunden hatte.
In einem höchst ungewöhnlichen Fall exkommunizierte ein südafrikanisches Rabbinatsgericht einen Geschäftsmann, weil er keine Unterhaltszahlungen für seine Kinder geleistet hatte, und erklärte, dass er nicht Mitglied einer Synagoge werden, nicht zu einem Gebetsquorum gezählt und nicht auf einem jüdischen Friedhof beerdigt werden könne. Der Mann legte Berufung bei einem säkularen Gericht ein, das 2014 gegen ihn entschied. Die Exkommunikation als Druckmittel für Ehemänner in Scheidungsverfahren wurde im Allgemeinen nicht angewandt, obwohl eine weniger formelle öffentliche Ächtung versucht wurde.
Der Talmud und die Cancel-Kultur
Im Allgemeinen waren die Rabbiner des Talmuds mit der Meinungsvielfalt einverstanden und bemühten sich sehr darum, dass Minderheitenmeinungen im Text als würdige Studienobjekte erhalten bleiben. In der Tat wird der Talmud oft als paradigmatisches Beispiel dafür angeführt, dass das Judentum vielfältige Standpunkte zulässt und sich weigert, unpopuläre Meinungen aus der Tradition zu streichen. Nichtsdestotrotz haben die Rabbiner eine Form der sozialen Aufhebung aufrechterhalten.
Eine bekannte Passage zum Thema Ächtung aus dem Traktat Moed Katan veranschaulicht einige Schlüsselmerkmale des rabbinischen Denkens zu diesem Thema:
Die Gemara berichtet, dass ein gewisser Metzger sich Rav Tuvi bar Mattana gegenüber respektlos verhielt. Abaye und Rava wurden mit dem Fall betraut und ächten ihn. Schließlich ging der Metzger hin und beschwichtigte seinen Streitpartner, Rav Tuvi. Abaye sagte: Was sollen wir in diesem Fall tun? Soll er von seinem Verbotsbeschluss befreit werden? Sein Ächtungsurteil ist noch nicht seit den üblichen 30 Tagen in Kraft. Soll er andererseits nicht aus der Ächtung entlassen werden? Aber die Weisen möchten seinen Laden betreten und Fleisch kaufen, und das ist ihnen im Moment nicht möglich.(Moed Katan 16a)
Es ist erwähnenswert, dass die talmudischen Rabbiner die Ächtung für etwas so scheinbar Geringfügiges wie Respektlosigkeit billigten. Es ist auch erwähnenswert, dass die Strafe nicht vom Pöbel verhängt wurde, sondern von zwei gelehrten Rabbinern, die vor Gericht saßen und entschieden, dass die Ächtung eine angemessene Strafe sei. Schließlich deutet der Text an, dass die Ächtung kein dauerhafter Zustand ist. Sie hat eine zeitliche Begrenzung, nach der der Sünder wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden kann.
Der Talmud enthält ein berühmtes Beispiel für eine dauerhafte Aufhebung: Elisa ben Abuja, ein einst angesehener Gelehrter, der zum Abtrünnigen wurde und fast vollständig aus dem Talmud gestrichen wurde und nur noch als aher, d. h. „anders“, bezeichnet wird. Die Details sind begrenzt, aber aus dem talmudischen Bericht geht klar hervor, dass Elisa, einst ein führender Gelehrter und Mitglied des Sanhedrin, die jüdische Gesetzestreue aufgab und zum Ketzer wurde, offenbar nach einer Begegnung mit Gott, die in dem berühmten Gleichnis von den vier, die in den Pardes (Obstgarten) gingen, beschrieben wird. Der Talmud respektierte also durchaus die Meinungsvielfalt, aber er duldete sicher nicht jede Meinung.
Schlussfolgerung
Duldet das Judentum also die Cancel-Kultur? Die jüdische Tradition schätzt unbestreitbar eine Vielzahl von Stimmen und Meinungsverschiedenheiten zu edlen Zwecken, aber sie befürwortet sicherlich nicht die Idee, dass jede Idee es wert ist, berücksichtigt zu werden. Und einige Ideen (und ihre Verfechter) werden als zu gefährlich oder schädlich angesehen, als dass man sie frei zirkulieren lassen könnte. Jüdische Führer, sowohl in der Antike als auch in der Neuzeit, haben sich verschiedener Mittel bedient, um sicherzustellen, dass bestimmte Grenzen für religiöse und andere Verhaltensweisen und Ideen eingehalten werden. Die Herausforderung besteht damals wie heute darin, zu bestimmen, wo diese Grenzen gezogen werden sollen.