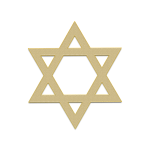BERLIN (JTA) – Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in der Stadt Frankfurt etwa 30.000 Juden, damit war sie, neben Berln, die zweitgrößte Gemeinde in Deutschland.
Als das US-Militär die Stadt 1945 besetzte, waren nur noch etwa 100 Juden übrig.
„Jüdisches Leben wurde zerstört“, sagte Tobias Freimüller, Autor des kürzlich erschienenen Buches „Frankfurt und die Juden“, einer Geschichte der Gemeinde von 1945-1990.
Ein Blick auf das Jahr 2020 zeigt, dass die jüdische Gemeinde Frankfurts wieder eine starke Kraft in der Stadt ist, die zu den größten und wichtigsten Wirtschaftszentren Deutschlands gehört.
Bekämpfung des Antisemitismus ist höchste Priorität
Es gibt nur etwa 6.600 Juden in der Stadt mit 753.000 Einwohnern, aber sie haben einen politischen Einfluss, den andere Minderheitenbevölkerungen nicht haben. Der derzeitige Bürgermeister, Peter Feldmann, ist Jude. Der Kampf gegen den Antisemitismus ist eine Priorität der Stadt. Jüdische Führer stehen in regelmäßigem Kontakt mit der Stadtspitze. Wenn es ein tragisches oder anderweitig berichtenswertes Ereignis gibt, ist immer ein Vertreter der jüdischen Gemeinde an der Reaktion der Stadt beteiligt.
„Wenn wir den Mund aufmachen, hören alle zu“, sagte Leo Latasch, ein Professor der Medizin, der für die Jüdische Gemeinde Frankfurt unter anderem für soziale Angelegenheiten und Sicherheit zuständig ist. „Wir haben ein ausgezeichnetes Verhältnis zu den demokratischen Parteien.“
Freimüller, stellvertretender Direktor des Fritz Bauer Instituts – einer der Goethe-Universität Frankfurt am Main angegliederten Holocaust-Forschungsstelle – berichtet in seinem am 15. April erschienenen Buch über das jüdische Wiederaufleben. Es ist eine komplexe Erzählung, sagen Mitglieder der jüdischen Gemeinde und ihr nahestehende Personen, weil die Zerstörung durch die Nazis so vollständig war; eine jüdische Präsenz musste mit Hilfe von außen wieder aufgebaut werden.
„Wiedergeburt klingt wie eine Wiederbelebung der Gemeinde“, sagte Esther Schapira, eine Journalistin und Filmemacherin, die in Frankfurt aufgewachsen ist. „Das ist nicht der Fall.“
Alteingesessene Juden und die ZWST
Nach dem Krieg gab es zwei Arten von Juden, die in Frankfurt verblieben waren. Es gab die wenigen Überlebenden, die 1947 die heutige Jüdische Gemeinde Frankfurt am Main gründeten und eine Rückkehr zu den Wurzeln der Gemeinde vor dem Krieg ins Auge fassten. Diese Gruppe bestand hauptsächlich aus assimilierten Juden, die sich als Deutsche verstanden und oft mit Nichtjuden verheiratet waren.
Diese Juden wurden Alteingesessene genannt, so die 30-jährige Laura Cazes, Mitarbeiterin der Frankfurter Zentralwohlfahrtsstelle des Zentralwohlfahrtsstelleder Juden in Deutschland (ZWST).
„Sie waren unverzichtbar, aber es gab nur sehr wenige“, sagte Cazes.
Dann gab es die Vertriebenen, oder DPs, die aus ganz Osteuropa kamen. Viele landeten als Boxenstopp auf dem Weg in die Vereinigten Staaten oder nach Palästina in Frankfurt, aber Einwanderung war zunächst nicht möglich. Stattdessen verbrachten Zehntausende jüdische DPs jahrelang in DP-Lagern, wie zum Beispiel in Frankfurt-Zeilsheim. Die Situation änderte sich 1948, als das britische Mandat in Palästina der Gründung des Staates Israel wich und die Vereinigten Staaten das Displaced Persons Act verabschiedeten und damit ihre Grenzen öffneten. Die meisten DPs verließen Deutschland, aber nicht alle konnten die Reise antreten.
„Einige blieben aus verschiedenen Gründen“, erklärte Freimüller. „Weil sie zu alt oder zu krank waren, weil sie kein Englisch oder Hebräisch sprachen, oder weil sie am Ende ein kleines Unternehmen gründeten oder einen anderen Weg fanden, um Geld zu verdienen“, erklärte Freimüller. 1949 schloss sich die Gemeindeorganisation mit dem Komitee der Vertriebenen zusammen. Insgesamt gab es zwischen den beiden Gruppen etwa 2.000 Juden.
Ein neuer Anfang
„Interessant ist, dass kaum jemand in der damaligen jüdischen Gemeinde aus der Stadt kam“, sagte Freimüller. „Die Zahl der Alt-Frankfurter [oder „Original-Frankfurter“] war recht gering. Das bedeutet, dass nur wenige in der jüdischen Nachkriegsgemeinde Frankfurt während der Nazi-Herrschaft sahen. Es war ein völliger Neubeginn und etwas, das sich die Gründer nicht hätten vorstellen können“.
Nach der Gründung der Bundesrepublik 1949 verabschiedete Westdeutschland Gesetze, um den Prozess der Entschädigung von Holocaust-Überlebenden in Gang zu setzen. Freimüller nannte es „ein Signal vor der deutschen Elite, der Presse und dem Volk, dass jüdisches Leben geschützt werden würde“.
Mit dieser Hilfe begann die Frankfurter Gemeinde auf- und auszubauen.
„Die meisten von ihnen waren Überlebende oder Kinder von Überlebenden aus Polen, Ungarn, der Tschechoslowakei und Rumänien“, sagte Cazes. „Die jüdische Gemeinde, die nach dem Krieg in Frankfurt aufgebaut wurde, hat eine ganz andere Identität“, so Cazes.
Nach den meisten Berichten vermieden die Juden in Frankfurt in den ersten Jahrzehnten nach dem Krieg das Rampenlicht. Jüdische Institutionen, so Freimüller, hätten sich vorsichtig an die Linie gehalten und seien im öffentlichen Leben zurückgezogen worden. Sie sprachen nicht darüber, was mit ihren Familien geschah. Aber das änderte sich 1985, während dessen, was Freimüller als einen entscheidenden Wendepunkt in der Geschichte der Juden im Nachkriegsdeutschland bezeichnet.
Die eigene Stimme finden
In den 1960er Jahren gestalteten Stadtplaner das ehemals bürgerliche und bis in die 1930er Jahre stark jüdisch geprägte Westend neu. Das Viertel wurde während des Krieges nur geringfügig beschädigt, und viele der Häuser der Oberschicht aus dem 19. In den 60er Jahren wollte die Stadt jedoch kommerzielle Hochhäuser entlang der zentralen Korridore des Westends bauen, weil das benachbarte Stadtzentrum überfüllt war.
Die Stadt begann damit, alte Häuser abzureißen und Bürogebäude zu errichten, doch dies führte zu Protesten – Hausbesetzer blieben in den zum Abriss vorgesehenen Häusern, und andere Demonstranten stießen auf den Straßen mit der Polizei zusammen.
Viele der Makler, die an den neuen Entwicklungen beteiligt waren, waren jüdisch, und das führte zu dem, was Freimüller als „antisemitische Untertöne“ im öffentlichen Leben bezeichnet. In den 1970er Jahren schrieb der bekannte Dramatiker Rainer Werner Fassbinder ein Theaterstück, das vom Nachbarschaftskonflikt inspiriert war. Das Stück „Müll, Stadt und Tod“ wurde wegen seiner als antisemitisch empfundenen Hauptfigur – einem Immobilienspekulanten namens Der reiche Jude – protestiert.
Obwohl das Stück veröffentlicht wurde, wurde seine Uraufführung 1975 nach Protesten abgesagt. Das Stück wurde erst 1985 aufgeführt, aber jüdische Einwände gegen den Inhalt blieben bestehen, und einige ergriffen während der Uraufführung Maßnahmen. Sie fälschten Eintrittskarten für die Premiere, und als das Stück begann, stürmten sie die Bühne und verhinderten, dass es aufgeführt wurde. Plötzlich hatten die Juden in Frankfurt ihre öffentliche Stimme gefunden.
„Viele betrachteten diese spektakuläre Aktion als einen Wendepunkt für die Darstellung der jüdischen Gemeinde in der Nachkriegszeit“, sagte Freimüller.
Ein neues Zuhause
In den letzten 25 Jahren haben die jüdischen Gemeinden in ganz Deutschland von einem Zustrom von Einwanderern aus der ehemaligen Sowjetunion profitiert. Die Familien, die gekommen seien, hätten aber in Frankfurt ihre Spuren hinterlassen – zum Beispiel gibt es ein jährliches Fest, das die russische Rolle bei der Beendigung des Zweiten Weltkriegs feiert. Die 59-jährige Schapira, deren Arbeit sich typischerweise auf die internationale Wahrnehmung Israels konzentriert, vermutet, dass Frankfurts liberales Ethos die neue jüdische Gemeinde gedeihen ließ, und stellte fest, dass sie auch türkische Einwanderer aufgenommen habe. Millionen von Menschen türkischer Abstammung leben in Deutschland, und mehr als die Hälfte der Frankfurter Bürger hat Migrationswurzeln.
„Frankfurt hat einen sehr liberalen Geist“, sagte Schapira und fügte hinzu, dass Spannungen mit muslimischen Gemeinden kein großes Thema seien. „Sie haben eine recht offene Atmosphäre, die es den Juden ermöglicht, wieder aufzublühen. In der Stadt gibt es eine große Synagoge, drei kleinere und einen Gebetsraum am Flughafen. Latasch beschreibt diese als überwiegend konservativ – im Gegensatz zu orthodoxen oder liberalen, anderen in Europa gebräuchlichen konfessionellen Begriffen – fügt aber hinzu, dass es „Möglichkeiten für Menschen gibt, die orthodox oder liberal sind“. Schapiras Vater war ein Überlebender aus Rumänien, der als Vertriebener in Frankfurt landete.
„Sie hatten nie die Absicht, hier zu bleiben oder hier zu leben“, sagte Schapira über ihren Vater und seine Altersgenossen. „Es war nur die Wartezeit, bis sie dorthin gehen konnten, wo sie hinwollten, das war hauptsächlich entweder Amerika, Argentinien oder Israel.
Aber Schapiras Vater war müde. Er hatte weder die finanziellen Mittel noch die körperliche Kraft, um die Reise nach Übersee zu unternehmen. Also schlug er Wurzeln in Frankfurt und heiratete eine nichtjüdische deutsche Frau. Obwohl sie in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, sagt Schapira, „die Idee, das Land zu verlassen“, habe sie immer im Hinterkopf gehabt.
„Vermischen Sie nicht zu viel. Machen Sie sich nicht zu vertraut. Fühlen Sie sich nicht zu sehr verwurzelt. Seien Sie auf der Hut. Seien Sie immer bereit, den richtigen Moment nicht zu verpassen, um das Land wieder zu verlassen“, waren nur einige der Botschaften, die sie, wie sie sagt, von ihrem Vater und anderen aus der Gemeinschaft gelernt hat.
Obwohl ein Umzug für Schapira und ihre Familie eine Möglichkeit gewesen war, blieben sie schließlich doch, weil, wie ihr Vater es ausdrückte: „Im Moment ist dies der sicherste Ort für Juden, weil die ganze Welt auf Deutschland schaut“. In ihrem nächsten Atemzug gibt sie jedoch zu, dass sich dies jederzeit ändern könnte. Die Erzählung verschiebt sich in der dritten Generation nach dem Holocaust, vertreten durch Menschen wie Cazes.
„Es gibt dieses Bild, über das die Leute reden würden, dass die Menschen auf gepackten Koffern sitzen“, sagt Cazes. „Erst die dritte Generation begann, diese Koffer auszupacken.“ Cazes glaubt, dass Frankfurt die jüdischste Stadt in Deutschland ist, wenn nicht in Zahlen, dann im Geiste.
„Die jüdische Gemeinde hat eine sehr starke Präsenz im kulturellen Bereich“, sagte Cazes. „Es handelt sich nicht um eine isolierte Gemeinschaft innerhalb der Stadt. Sie ist sehr, sehr präsent.“
So sehr die Gemeinde im heutigen Frankfurt auch ihren Einfluss geltend gemacht hat und so sicher sie sich auch fühlen mag, sagt Schapira, dass alle Juden immer noch über das Weggehen nachdenken – egal, zu welcher Generation sie gehören.
„Ich glaube, das gilt auch für die dritte Generation“, sagte sie. „So sehr sie den Koffer auch ausgepackt haben, sie haben ihn nie weggeworfen, also ist es keine so große Sache, wieder zu packen“.